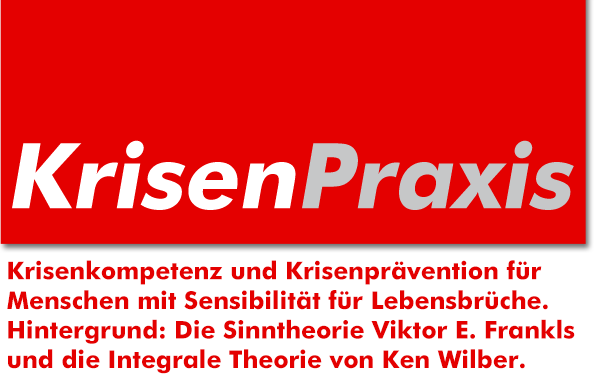Woran erkennt man, dass ein Mensch lebt? Einfach gesagt daran, dass er sich verhält. Körperlich und/oder psychisch, in den meisten Situationen psychophysisch. Damit ist noch nicht gesagt, ob er gut lebt, gesund lebt, … Und auch ist damit nicht erkannt, warum er so lebt, wie er lebt. Und auch nicht, worum es ihm geht, wenn er lebt. Um Antworten auf diese Fragen zu finden, müssen wir dahin schauen, was der Urgrund individuellen Verhaltens ist. Es sind die Werte der Person.
Wir wissen, das Genom ist die komplette Erbinformation eines Lebewesens. Es besteht aus DNA und enthält alle Gene, die nötig sind, um den Organismus aufzubauen und seine Funktionen zu steuern. Epigenetische Marker können dabei beeinflussen, welche Gene ein- oder ausgeschaltet werden, ohne die DNA-Sequenz selbst zu ändern. Dabei docken kleine Moleküle an einen DNA-Strang an. Sie verhindern, dass eine benachbarte Gensequenz abgelesen und in ein Protein übersetzt wird. Der Genabschnitt bleibt stumm. Es gibt Hinweise darauf, dass bestimmte Umweltfaktoren, Stress oder Traumata solche epigenetischen Marker erzeugen können, die dann wie das Genom selbst an Nachkommen weitergegeben werden.
Insgesamt kann man das Genom wie einen Bauplan oder eine ‚Software‘ für den menschlichen Körper verstehen. Was jedoch die Person aus diesem Bauplan macht, liegt in ihrer Freiheit und Verantwortung. Ob ich also eine Stupsnase habe, liegt am Genom, ob ich andere an der Nase herumführe oder nicht, am Einsatz meiner Freiheit und Verantwortung.
Ein Beispiel: Eine legasthenische Störung (Legasthenie) ist eine spezifische, weitgehend genetisch bedingte Entwicklungsstörung des Lesen- und Schreiblernens, die durch tiefgreifende, dauerhafte Schwierigkeiten im Schrifttexterwerb gekennzeichnet ist. Eine diagnostizierte Störung ist zu ca. 70% vererbt. Mehr als zwanzig verschiedene Gene oder Genorte sind bekannt, die eine Rolle bei der Entstehung einer Legasthenie spielen. Allgemein kann man sagen: Vieles an einem genetischen Bauplan, wie zum Beispiel der beschriebenen Störung, kann die Person nicht direkt beeinflussen – hier braucht es zur Unterstützung der Person geeignete Hilfsmittel.
Eine Lese-Rechtschreib-Schwäche dagegen ist eine weitgehende erworbene, oft vorübergehende Schwierigkeit, die durch äußere Umstände wie schlechte Lernmethoden, familiäre Probleme oder physische Ursachen wie eine längere Krankheit verursacht wird und wieder behoben werden kann. Dass hierbei nun – nach der fachmännischen Aufklärung des Phänomens – die Freiheit und Verantwortung der betroffenen Person zum Einsatz kommen muss und maßgeblich den Erfolg des Entwicklungsprozesses bestimmt, liegt auf der Hand. Damit dies geschieht, hat die Person auf eine Frage ihres Lebens zu antworten, eine Frage, die in diesem Fall vielleicht lautet: „Willst Du mich, Dein Leben, ohne eigenständigen Zugang zu geschriebenen Geschichten, Dokumenten, Büchern und Nachrichten führen?“ Lautet die Antwort nein, weiß die Person offenbar, worum es ihr nun zu gehen hat. Dann hat sie einen guten Grund für ihre Stellungnahme. Lautet die Antwort ja, dann hat die Person offenbar bereits einen Grund, den sie in der Lage sein sollte, auszusprechen.
Kurz: Alles, was ein Mensch durch seine Umwelt, durch Übung und Erfahrung lernt oder auch nicht lernt, wird nicht direkt durch die DNA [hier ein KI generiertes Bild] vorgegeben. Wenn es das Genom also weitgehend nicht ist, was einen Menschen in seine Entwicklung mittels Lernen und Selbstdenken führt, dann stellt sich die Frage, was es denn dann ist? Was löst der Mensch aus, wenn er seine genetische ‚Software‘ in Anwendung bringt?
Für die Antwort auf diese Frage können wir nun neben der Welt der Gene das Reich der Werte stellen. Werte werden durch Verhalten sichtbar. Was bereits ein Kind an Verhalten bei anderen Menschen wahrnimmt, sind letztlich sichtbar gewordene Werte dieser Personen. Wir können annehmen, dass die unmittelbaren Bezugspersonen des Kindes mit ihren Verhaltensweisen die ihnen zugrunde liegenden Werte auf das Kind projizieren – bewusst oder unbewusst. Inwieweit das Kind diese Projektionen dauerhaft internalisiert, liegt in der Freiheit und Verantwortung des Kindes. Dabei können wir annehmen, dass ein Kind, das Verhaltensweisen entwickelt, die den Wertmaßstäben der Bezugspersonen Rechnung tragen, Wertschätzung erfährt. Ein solches Kind ist dann ‚einer von uns‘, ‚aus meinem Holz geschnitzt‘, ‚wie der Vater so der Sohn‘ usw. – ein solches Kind zeigt eine Art Deckungsgleichheit der Werte an. Man könnte es auch so formulieren: die Bezugsperson hat ihren berechtigten Auftrag, das Kind zu sich zu ziehen, angenommen und wahrgenommen. ‚Er-Ziehung‘ hat funktioniert. Eines Tages wird sich der erwachsene Mensch dann womöglich darüber wundern, dass er Verhaltensweisen zeigt, die er irgendwie mit denen der Bezugsperson(en) als vergleichbar ansieht.
Was aber, wenn das eigene Kind ‚aus der Art schlägt‘, wenn es Verhaltensweisen zeigt, die sich mit den eigenen Vorstellungen nicht in Deckung bringen lassen? Gelingt es der Bezugsperson, dieses ‚Anders-werden‘ des Kindes anzuerkennen, dann kann auch dies als Ausdruck bestimmter Werte angesehen werden, die es ihr erlauben, ein solches ermöglichendes Verhalten zu zeigen. Mit Viktor Frankl kann argumentiert werden: Jeder Mensch hat Bedingungen (hier: jeder Bezugsperson werden durch ihr Kind Bedingungen aufgezeigt), doch jeder Mensch kann sich frei und verantwortlich so oder so zu diesen Bedingungen stellen (zum Beispiel so: abweisend, sanktionierend oder so: ermöglichend, unterstützend). Umgekehrt gilt dies auch für das Kind.
Findet durch Entwicklung zunehmender Reflexivität des Kindes, des Jugendlichen, ein Prozess des Selbstdenkens statt, dann vermag die junge Person sich gegen die projizierten Verhaltensmuster und die ihnen zugrundeliegenden Werte aufzulehnen oder sie als gut für die eigenen Entwicklung anzukennen, sie zu revidieren oder umzuformen. So entsteht sukzessive das eigene Wertesystem, in dem internalisierte und akzeptierte Werteprojektionen auf der einen Seite und durch Selbstdenken entwickelte, individuelle Werte auf der anderen Seite zusammenkommen. Der selbstdenkende Mensch setzt so – analog zum Bild der epigenetischen Marker – seine Wertemarker.
In einer Werteanalyse lässt sich herausarbeiten, welche Werte in einem individuellen Wertesystem sich als Werteprojektion und welche als Ergebnis eigener Werteentwicklungsprozesse angesehen werden können. Zuweilen formulieren Menschen dann im Rahmen einer solchen Analyse den Wunsch, für die vor ihnen liegende Lebensphase weiteren Werten mehr Bedeutung einzuräumen oder sich von (weiteren) Werteprojektionen zu lösen. Solche Prozesse sind möglich – an sich lebenslang. Eine Entscheidung dafür kann nie die Empfehlung von Dritten sein – denn jede Empfehlung basiert letztlich auf dem Wertesystem des Empfehlenden. Würde eine Person einer solchen Empfehlung folgen, dann liefe sie Gefahr, an einem wesentlichen Punkt das Leben eines anderen zu leben. In der Logotherapie oder im Sinncoaching stellen wir daher ’nur‘ die Mittel zur Verfügung, nicht aber das ‚Rezept‘ aus für diese Form der Entwicklung. Es ist zu beachten: Eine Werteentwicklung hat Folgen, zum Beispiel hinsichtlich eigener Erziehungsformen, dem Beibehalt angenommener Rollen und Beziehungen, der Veränderung von teilweise lange etablierten Verhaltensweisen und anderem mehr. Dies darf und kann nur in der Freiheit und Verantwortung dessen stehen, der sich auf seine persönliche Reise ins Reich der Werte aufmacht.