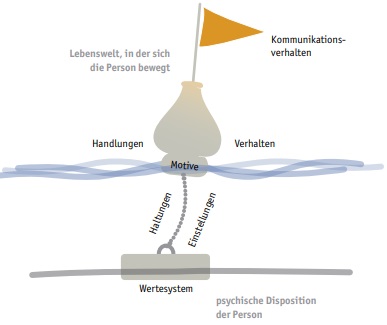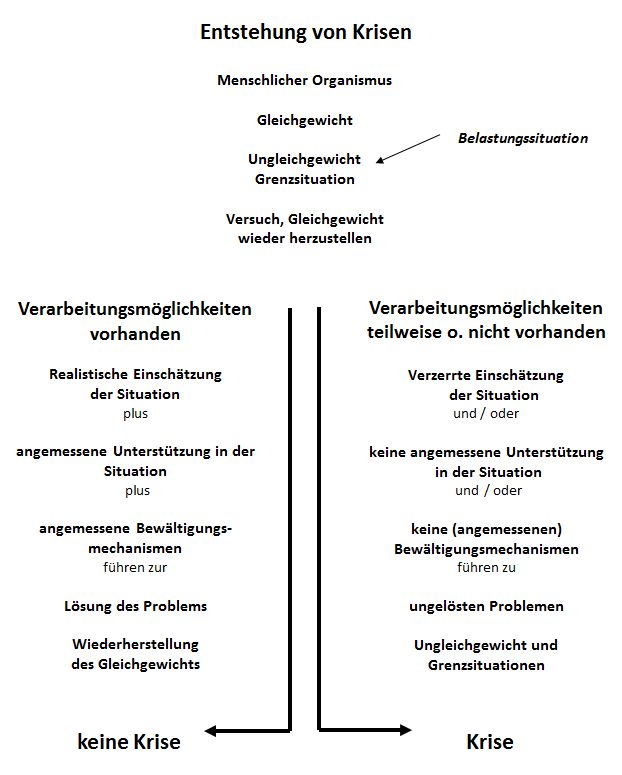Da verletzt sich ein Mann an einem Messer, infiziert sich mit Streptokokken, bekommt rasant eine lebensgefährliche Sepsis und stellt sich irgendwann die Sinnfrage. Über die er dann in einem Buch schreibt, das schnell zum Spiegel-Bestseller wird. Wie es in vielen Büchern steht, fragt sich auch diese Person, was ist Glück und kommt zum mittlerweile trivialen Schluss: Geld und Macht sind es nicht. Gut, das sehen manche noch anders, aber lass diese Menschen erst mal eine Sepsis haben.
Und – kaum zu glauben – der Autor entfaltet seine Gedanken hin zur waghalsigen Idee, dass es wohl Beziehungen sind, die dem Menschen zum Lebensglück verhelfen. Nun, dass wir soziale Wesen sind und wir alle systemisch miteinander verbunden sind, haben viele schon gelernt und immer mehr begreifen auch, dass es wirklich so ist, dass das Verhalten eines Menschen im brasilianischen Urwald ein wenig dazu beiträgt, wie wir uns in Augsburg verhalten. Und umgekehrt. Und austauschbar, egal wo ein Mensch lebt. Dass das mit dem Begreifen der systemischen Wirklichkeit fraglos noch besser laufen kann, beweist uns jeden Tag die Natur. Sie lässt sich bewahren oder zerstören, nur kann man mit ihr nicht verhandeln oder einen Deal machen. Die Natur führt uns immer und überall in die Entscheidung: so oder so. So verhalten oder so verhalten. Wir können uns lustvoll verhalten, oder machtvoll, oder voll-ständiger, oder sinnvoll. Das haben uns die vier wichtigsten Schulen der Psychotherapie gelehrt, und andere Schulen haben diese Seins-Richtungen weiter aufgefächtert, manchmal auch verschlimmbessert.
Wenn nun der Autor das Lebensglück in ‚Beziehungen‘ wähnt, was bedeutet das dann aus der Perspektive der vier Schulen? Wie bringt man Trieb und Beziehungen, Macht und Beziehungen, Individuation und Beziehungen oder Sinn und Beziehungen zueinander und worum geht es einem Menschen je nach Perspektive?
Ein Klient eines hidden champions aus dem Mittelstand berichtet mir, dass er seine jüngsten Beziehungen über Datingplattformen gefunden hat und dass er dabei immer wieder konkret nachfragt, wie viele Beziehungen die auserkorene Person denn schon hatte. „Schließlich will ich im Bett nicht erst Nachhilfeunterricht geben“. Okay, diese Haltung kann man haben. Im Job beschreibt er sich seines Einflusses durchaus bewusst. „Fehler macht man bei Menschen am Anfang, nicht am Ende“, sagt er und so prüft er jede neue Beziehung auf seine Robustheit und Loyalität. „Wer da durch mein Raster fällt, ist draußen, denn auf dem Markt sind meine Gegner, die mich fordern und da will ich meine Energie nicht mit Inhouse-Gegnern vergeuden.“ Okay, diese Haltung kann man haben. Für seine eigene Erbauung nutzt er regelmäßig Retreats in einem Kloster. „Da baue ich quasi meinen Seelenmüll ab und mein Immunsystem wieder auf. Mit den Brüdern spreche ich gerne, denn in der Beziehung zu ihnen merke ich immer den Zwang, dem sie unterliegen. Sie nennen es Freiwilligkeit. Ich nenne es Unterwerfung. Nach der Zeit im Kloster ist mir klar, dass ich meinen Weg weitergehe.“ Okay, diese Haltung kann man haben. Ich frage den Klienten, worin das besteht, was ihn am meisten erfreut. „Wenn ich weltweit unterwegs bin und sehe, dass unsere Produkte hoch wirksam und auch unter extremen Bedingungen in der Lage sind, äußerst sensible technische Geräte nach ihrer Nutzung schnell wieder keimfrei zu machen und dadurch zum Wohl gefährdeter Menschen und Ressourcen lange im Einsatz bleiben können, dann erfreut mich das jedes Mal. Das ist das, worum es mir geht.“ Okay, diese Haltung kann man haben.
Würde mit dieser Person (keine Kinder, Vater in Südamerika lebend, viele Freunde, Liebhaber alter französischer Autos, Kenner des Portweins …) weitergesprochen, dann fänden wir wohl weitere Beziehungen in unterschiedlichster Bedeutung.
- „Fühlen Sie sich glücklich?“ „Glück ist keine Kategorie für mich.“
- „Was dann?“ „Ein Container-Begriff, nicht mehr.“
- „Wenn es ein Begriff ist, der für Menschen etwas positiv Erreichtes bedeutet. Was wäre dann der für Sie passende?“ „Lebendigkeit.“
- „Gibt es etwas aus Ihrer Erzählung, das dem, was für Sie ‚Lebendigkeit‘ bedeutet, am ehesten entspricht?“ „Nein, alles, was ich beschrieben habe ist Teil meiner Lebendigkeit. Das fühlt sich insgesamt gut an.“
- „Gibt es einen Unterschied zwischen der Lebendigkeit und der Freude?“ „Die ist für mich sowas wie ein seltenes Sahnehäubchen, wenn ich sehe, welchen Beitrag ich eingebracht habe. Die Lebendigkeit ist quasi der notwendige Grundton und die Freude entsteht für mich in den seltenen Momenten der Resonanz.“
- Gibt es Menschen, die eine Lebensfreude in Ihnen so auslösen wie die Situationen, die Sie beschrieben haben, wenn Sie in der Welt Ihre Beiträge sehen? „Nein. Ich werde von vielen Menschen verstanden, und das reicht mir. Ich kenne viele, die sich nicht verstanden fühlen und sich daraus ein Problem machen, das sie nicht lösen können und dann von Unglücklichsein sprechen.“
Halten wir das Gespräch, das im Rahmen eines Coachings zur Krisenprävention geführt wurde, hier einmal an und kommen zurück zum Bestseller-Buch, in dem von ‚Beziehungen sind die Basis von Glück‘ gesprochen wird. Ich möchte meinen, dass hier eine Person einen Lebensentwurf beschreibt, der dazu aufrufen kann, genauer zu schauen, was für einen selbst das ist, was man aus einer Beziehung ‚be-zieht‘. Nutzen wir hierzu aus dem integralen Kontext der bereits in der KrisenPraxis beschriebenen vMeme von Graves die Hinweise zu den unterschiedlichen Ebenen der Bewusstheit, dann können wir in den Ausführungen des Klienten situativ das Thema ‚Beziehung‘ einmal mit dem Ich-vMeme Rot (Stärke, Dominanz, Abgrenzung, Macht) in Verbindung bringen. Dann aber auch in den Kontext des Übergangs von Rot zu Blau, wenn es darum geht, dass der Klient entscheidet, wann sich wie eine Person sich ihm gegenüber loyal verhält. Die Gespräche wiederum, die er mit seinen Sparringspartnern im Kloster führt, scheinen Hinweise zu geben auf ein Ich-vMeme Orange, das sich deutlich von einer ‚Unterwerfung‘ (Wir-vMeme Blau: Regelsysteme und Glaubensordnung) abheben will, das er im Lebensmodell seiner Gesprächspartner entdeckt. Im Wir-vMeme Grün schließlich findet der Klient in der Beziehung zur Wirkung seiner Beiträge eine Resonanz, die ihn erfreut. Mit seinem vMeme Orange wird diese Resonanz utilisiert, im Sinne eines ‚es ist gut, dass ich einen Beitrag leiste (Orange), der zum Wohl eines größeren Ganzen (Grün) führen kann‘.
Meine Hypothese lautet hier: Angesichts eines Impulses, den der Klient irgendwann irgendwo erreichte und ihn dazu aufrief, etwas in die Welt zu schaffen, das als Gegenentwurf für ein bestehendes Problem dienen könnte, hat er gehandelt. Dabei wurde das bestehende Problem für den Klienten zu einem Gegenstand, auf den er sich seither bezieht – mit seinen Kompetenzen und mittels Verwirklichung seiner Werte. Die Beziehung zu diesem Gegenstand aufrechtzuerhalten, diese Beziehung zu gestalten, etwas für sie zu tun, erfüllt den Klienten mit dem Gefühl von Resonanz, die ihn erfreut.
Jetzt frage ich Sie, die Leserin, den Leser dieses kurzen Beitrags: Hatten Sie Vorurteile bezüglich des Klienten als Sie seine ersten Ausführungen zum Thema ‚Beziehungen‘ lasen? Hatten Sie ein Vorurteil hinsichtlich seiner Haltung zum Thema ‚Glück‘? War er Ihnen sympathisch – grundsätzlich ja oder nein? Oder wenn Sie ahnen, wie er seinen Trieb auszuleben versucht, oder seine Macht, oder seine Suche nach voll-ständigerer Entwicklung? Oder, wenn es für ihn um eine Sinnerfüllung ging?
Übrigens: Der Buchtitel lautet ‚Jetzt gerade ist alles gut‘.
Ich will meinen: Wie passend, denn es geht wirklich darum, auf das ‚jetzt gerade‘ zu schauen.
Integraler betrachtet: Ein Mensch, der Beziehung (jetzt gerade) aus einem vMeme Grün heraus gestaltet, setzt ein völlig anderes Bewusstheits-Schema ein als jemand, der das Thema Beziehung (jetzt gerade) mit einem Schema entlang eines vMeme Purpur, Rot, Blau … gestaltet.
(Und – kleine Übung – nehmen Sie statt des Begriffs Beziehung einen konkreteren Stellvertreter wie beispielsweise Unterhaltung mit A …, Sex mit B …, Freundschaft mit C …, Ehe mit D, Nachbarschaft mit E …, Projekt X, Projekt Y, Vater, Mutter, Kind, Gott, Haustier … also einen Begriff, der eine emotionale, kognitive und-oder soziale Beziehung mit oder zu Jemandem oder Etwas beschreibt, dann können Sie überlegen, welches vMeme die Grundlage Ihres Verhaltens und Ihrer Handlungen in jedem dieser Kontexte ist, und zwar so als wären Sie ‚jetzt gerade‘ in der jeweiligen Be-ziehung.)
Beziehungen an sich und für mich, so mein Resümee, sind niemals die Basis möglichen Lebensglücks.
Beziehungen, die für jemanden oder für etwas gestaltet werden, um Resonanz zu ermöglichen, schon.